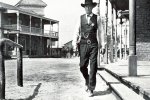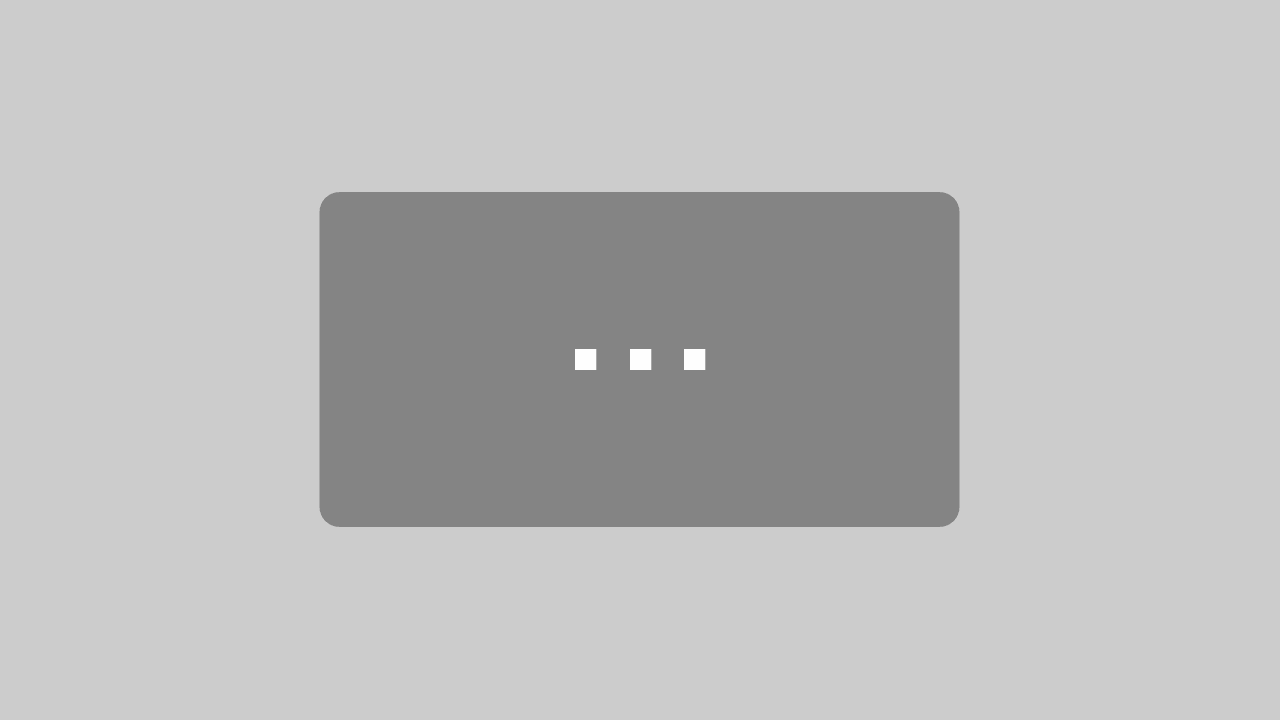Autoritäre vs. demokratische Pädagogik in strittigen Trennungsfamilien
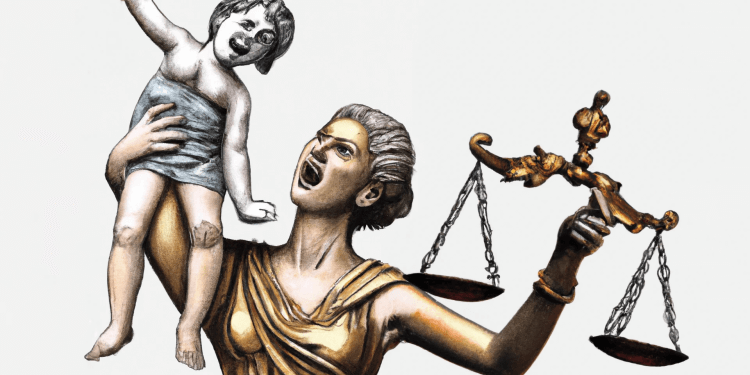
Dieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen der herrschenden, autoritären Staatspädagogik und einer demokratischen Pädagogik, die eigentlich das Leitbild der staatlichen Institutionen sein sollte.
In Deutschland hat sich seit 2017 eine besorgniserregende Tendenz in der Familienpolitik abgezeichnet: Eine autoritäre Staatspädagogik prägt den Umgang mit strittigen Trennungsfamilien. Statt Pluralität und individuelle Erziehungsansätze zu fördern, wird eine einheitliche, oft restriktive Haltung gegenüber Familien, die sich in Konflikten befinden, eingenommen. Diese Entwicklung hat tiefe Wurzeln in den dominierenden pädagogischen Ansätzen des Landes und beeinflusst, wie der Staat auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern und ihren getrennten Eltern reagiert.
Während die autoritäre Pädagogik im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf einer klaren Führung und Einheitlichkeit in der Erziehung besteht, betont die demokratische Pädagogik die Bedeutung von Pluralität und Gleichberechtigung.
Autoritäre Pädagogik: Einheit um jeden Preis
Für Befürworter der autoritären Pädagogik ist der Streit zwischen getrennten Eltern ein Alarmsignal. Sie sehen darin eine Gefahr für das Kind und erwarten, dass die Eltern ihre Differenzen beiseitelegen und eine erzieherische Einheit bilden. Wenn dies nicht gelingt, sollte der Staat eingreifen und einem Elternteil die alleinige Hoheitsgewalt über das Kind übertragen. Dieses Modell, oft als #Residenzmodell bezeichnet, zielt darauf ab, dem Kind eine klare Führung und Stabilität zu bieten. Innerhalb dieser Denkweise wird angenommen, dass das Kindeswohl am besten durch eine einheitliche Erziehung gewährleistet wird.
Demokratische Pädagogik: Pluralität als Stärke
Im Gegensatz dazu steht die demokratische Pädagogik, die den Streit der Eltern als Ausdruck von Meinungsverschiedenheiten und möglicherweise unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen sieht. In einer Demokratie, in der Pluralität und Meinungsfreiheit geschätzt werden, sollte das Kind die Möglichkeit haben, beide Perspektiven gleichwertig zu erleben. Anhänger dieses Ansatzes fordern daher eine gleichberechtigte Betreuung, oft als #Wechselmodell bezeichnet. Sie sehen darin eine Möglichkeit, das Kindeswohl durch die Exposition gegenüber verschiedenen Erziehungsmethoden und -vorstellungen zu fördern.
Die totalitäre pädagogische Agenda Deutschlands
Die aktuelle Bundesfamilienministerin Lisa Paus steht klar im Lager der autoritären Pädagogik. Ihre Positionen und Äußerungen deuten darauf hin, dass sie eine staatlich verordnete, einheitliche Erziehung bevorzugt, die eine plurale Erziehung in Trennungsfamilien verhindert. Diese autoritäre Pädagogik wurde durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshof im Jahr 2017 zur rechtlichen Doktrin für Familiengerichte in Deutschland erhoben und in nachfolgenden Beschlüssen ausgebaut. Damit hat Deutschland die autoritäre Pädagogik zur staatlichen Doktrin erhoben, was strittige Trennungsfamilien in ein totalitäres System zwingt.
Schlussfolgerung
Die autoritäre Staatspädagogik, die sich in Deutschland gegenüber strittigen Trennungsfamilien im Jahr 2017 mit der BGH-Entscheidung durchgesetzt hat, wirft ernsthafte Fragen über die zugrunde liegenden Werte und Prioritäten der Familienrechtsprechung und -politik auf. Anstatt die Vielfalt der Familienstrukturen und Erziehungsansätze zu respektieren, bevorzugt der Staat eine rigide, einheitliche Haltung, die nicht im besten Interesse der Kinder im Kontext unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Strittige Trennungsfamilien leiden seit 2017 unter einer totalitären Staatspädagogik.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Familienpolitik und -rechtsprechung zukünftig an den Prinzipien der demokratischen Pädagogik orientiert, um sicherzustellen, dass die Rechte und das Wohl der Kinder in strittigen Trennungsfamilien im Sinne des Grundgesetzes gewahrt werden.